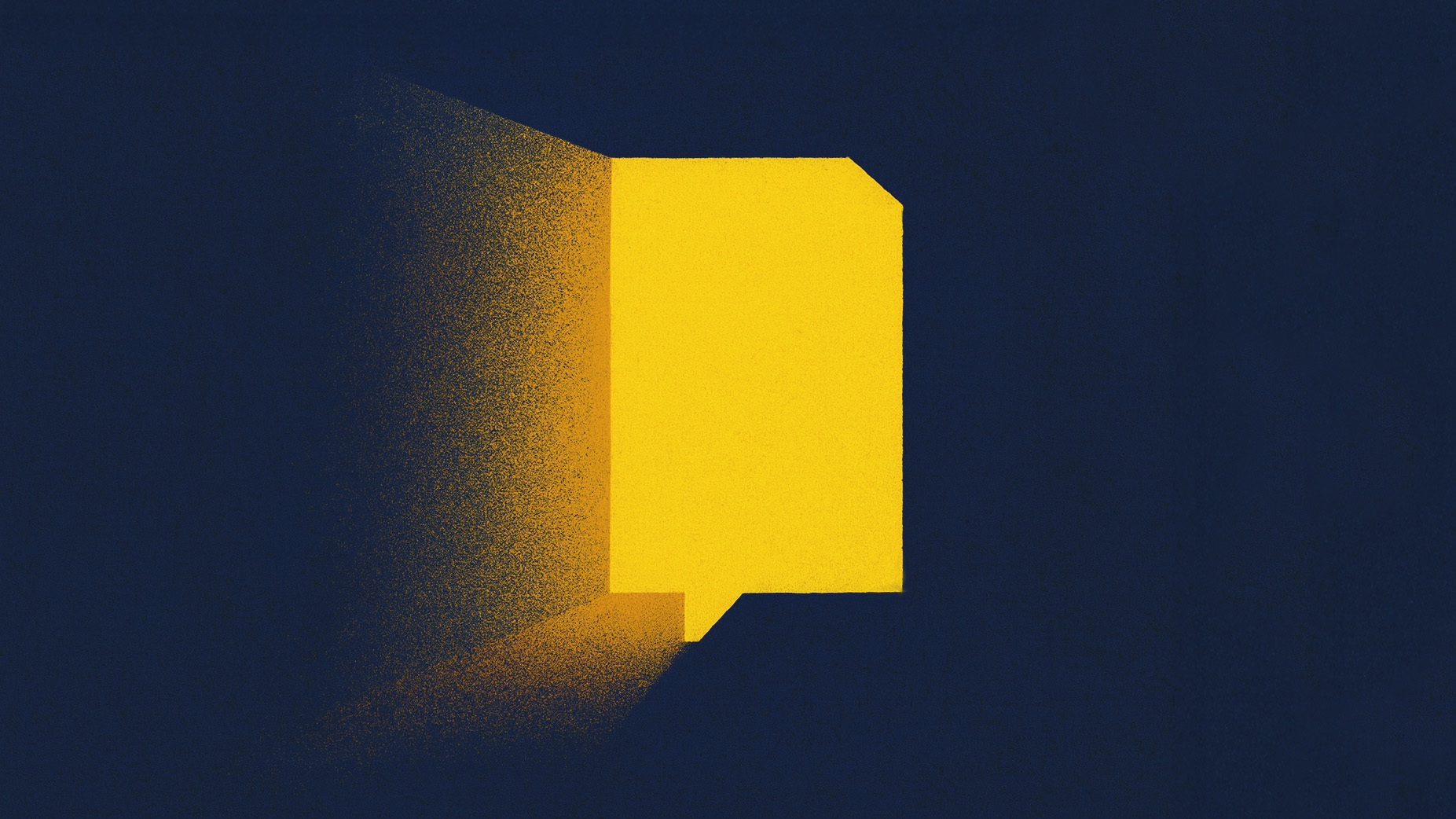Leere Plätze im Rathaus. Der Kaffee ist bereits kalt geworden. Die üblichen Verdächtigen debattieren, während der Rest der Kommune ungehört bleibt. So sah die Bürger*innenbeteiligung früher aus - und sogar vielerorts heute immer noch.
Jedoch ändern sich die Erwartungen der Bürger*innen und die verfügbaren Hilfsmittel nehmen zu. Die Kommunalverwaltungen, die dies erkannt haben, kombinieren bereits Online- und Offline-Methoden zu einer zeitgemäßen Herangehensweise: einer Hybridstrategie, die auf Effektivität ausgelegt ist.
Hybride Beteiligung: ein Begriff, viele Ansätze
Sie fragen sich immer noch, was es wirklich bedeutet, Online- und Offline-Beteiligung zu kombinieren? Damit sind Sie nicht allein.
Es gibt keine einheitliche Formel - und die Art und Weise, wie Sie die Methoden kombinieren, kann einen großen Unterschied machen.
Manchmal werden digitale Methoden und Formate vor Ort in unterschiedlichen Phasen eines Projekts angeboten. So können Sie z. B. mit einer Online-Umfrage beginnen, dann eine Bürger*innenversammlung veranstalten und später über eine Projektwebsite zu Kommentaren aufrufen.
In anderen Fällen werden Online- und Offline-Optionen parallel angeboten, so dass die Menschen die Wahl haben, in derselben Phase auf die Art und Weise teilzunehmen, die ihnen am ehesten zusagt. Ein Beispiel dafür ist die Beantwortung einer Umfrage, entweder an einem öffentlichen Stand oder über eine digitale Beteiligungsplattform..
Beide Ansätze können effektiv sein. Es kommt darauf an, die richtige Mischung zu wählen und dass es auf Ihre Projektziele, die Zielgruppe und den Kontext abgestimmt ist.
„Bei der hybriden Beteiligung geht es nicht mehr darum, zwischen verschiedenen Methoden zu wählen - es geht darum, das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit für die richtige Zielgruppe einzusetzen, um Ihre Projekte erfolgreich zu machen.“
Vorteile hybrider Bürgerbeteiligung
Wir alle waren schon einmal bei einem Planungsgespräch dabei, bei dem die Befürworter der digitalen Medien und die Verfechter der traditionellen Öffentlichkeitsarbeit unterschiedliche Sprachen zu sprechen scheinen. „Wir brauchen eine Social-Media-Kampagne“, meint der eine. „Aber unsere Senioren verlassen sich auf das gedruckte Informationsheft“, argumentiert ein anderer.
Das Gute an einer hybriden Beteiligungsstrategie ist, dass sie über diese falsche Wahl hinausgeht. Durch die Kombination von Online- und Offline-Methoden können Sie Folgendes erreichen:
- Größere Reichweite - Mehr Menschen werden von Ihren Projekten erfahren, wenn Sie sie dort abholen, wo sie sind: online, offline oder beides.
- Inklusion und bessere Repräsentation - Sie können alle Einwohner*innen einbeziehen, auch diejenigen mit Mobilitäts- oder Sprachbarrieren, eingeschränktem digitalen Zugang oder vollen Terminkalendern.
- Stärkere Beteiligung - Mehrere Optionen reduzieren Reibungsverluste und erleichtern die Teilnahme an Ihren Projekten.
- Kosten- und Zeiteffizienz - Digitale Tools verringern den manuellen Aufwand und ermöglichen es Ihnen, Ihre Reichweite zu skalieren.
- Bessere Daten - Sammeln Sie vielfältigeren, qualitativ hochwertigen Input.
- Klügere Entscheidungen - Repräsentativeres Feedback führt zu einer Politik, die die Bedürfnisse der Gemeinschaft besser widerspiegelt.
- Stärkeres Vertrauen - Transparenz und Reaktionsfähigkeit schaffen dauerhafte Beziehungen und Glaubwürdigkeit.
Hybride Beteiligung mag zwar nicht mehr revolutionär sein, sie ist aber auch nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, wohlüberlegte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Methoden wann eingesetzt werden und wie man sie kombiniert, um eine maximale Wirkung zu erzielen.
"Unsere Erfahrung mit hybrider Beteiligung: Die Bürger*innen werden abgeholt, wo sie sind: In den Schulen, in den Quartieren (...). Es lohnt sich, um einen einigermaßen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen."
Karin Engelhardt
Drei Schritte, damit die Beteiligung tatsächlich funktioniert
Aber wie funktioniert das in der Praxis? Hier sind drei Schritte, um eine Beteiligung zu entwickeln, die tatsächlich Ergebnisse liefert.
1. Kennen Sie Ihre Gemeinde
Bevor Sie eine einzige Umfrage starten oder ein einziges Treffen anberaumen, sollten Sie herausfinden, wer in Ihrer Gemeinde Teil Ihrer Zielgruppe ist und wie sie am liebsten in den Dialog treten.
Selbst die besten Absichten zur Beteiligung können scheitern, wenn Sie die falsche Methode verwenden. Wenn Sie sich zum Beispiel in einem Viertel, in dem viele Bewohner*innen keinen zuverlässigen Internetzugang haben, ausschließlich auf digitale Tools verlassen, werden wichtige Stimmen ausgeschlossen. Eine kritische Feedback-Sitzung während der Ferienzeit zu planen mag zwar praktisch sein, aber viele Einwohner*innen sind wahrscheinlich zu beschäftigt oder nicht verfügbar, um daran teilzunehmen.
Unser Tipp: Machen Sie es wie die belgische Stadt Gent bei ihrem Bürgerhaushaltsprojekt: Erstellen Sie „DNA-Profile der Viertel“, in dem nicht nur die demografischen Daten, sondern auch die Kommunikationspräferenzen und das Maß an Vertrauen in die Verwaltung erfasst werden. Auf dieser Grundlage wurde während des Prozesses zwischen digitalen und analogen Methoden gewechselt.
2. Wählen Sie die richtigen Methoden - und lassen Sie sie zusammenarbeiten
Sobald Sie Ihre Zielgruppe kennen, müssen Sie entscheiden, wie Sie sie ansprechen und mit ihr kommunizieren wollen. Das bedeutet, dass Sie Methoden und Kanäle auswählen müssen, die auf die Zielgruppe, das jeweilige Thema und die verfügbare Zeit und Ressourcen abgestimmt sind.
Eine starke hybride Beteiligungsstrategie geht von einem einfachen Prinzip aus: Planen Sie sowohl eine Online- als auch eine Offline-Beteiligung ein, wann immer dies möglich ist. Wenn die Ressourcen begrenzt sind, wenn eine Gruppe auf digitalem Wege besonders schwer zu erreichen ist oder wenn Sie über einen Kanal eine starke Anziehungskraft erzielen, können Sie die Balance anpassen.
Fragen Sie sich selbst:
- Wen versuchen Sie zu erreichen? Manche Einwohner*innen reagieren vielleicht auf eine Online-Umfrage am Telefon, andere bevorzugen vielleicht ein kurzes Gespräch auf dem Wochenmarkt.
- Was ist für Ihr Team machbar? Ihre Kapazität ist wichtig. Wenn Sie nur eine Methode gut beherrschen, tun Sie das, aber seien Sie transparent und suchen Sie nach Möglichkeiten, die Lücken im Laufe der Zeit zu schließen.
- Welche Formate sind am integrativsten? Berücksichtigen Sie die Zugangsvoraussetzungen, die Sprache, die Vertrautheit mit der Technologie und das Vertrauen.
- Wie kommunizieren Sie? Die Öffentlichkeitsarbeit ist genauso wichtig wie die Methode selbst. Das kann bedeuten, dass Sie Plakate und Flyer mit QR-Codes übersetzen, in Instagram-Stories erklären, wie man teilnimmt, oder Updates per E-Mail versenden.
Tipp: Achten Sie darauf, dass Ihre Botschaften, Ihr Bildmaterial und Ihr Sprachstil auf allen Kanälen einheitlich sind. Die Menschen sollten Ihr Beteiligungsprojekt erkennen, egal, wo sie ihm begegnen.
Und was ist mit der Komplexität? Sie ist zwar ein Faktor, sollte aber kein Hindernis für den Einstieg in die Digitalisierung sein. Mit der richtigen Einstellung kann Online-Beteiligung sogar differenzierte Diskussionen unterstützen.
3. Kompetenz durch Anwendung
Bei einer guten Beteiligung geht es nicht darum, beim ersten Mal alles richtig zu machen. Es geht darum, zuzuhören, zu lernen und sich bei jedem Schritt zu verbessern. Nehmen Sie sich also die Zeit, um zu verstehen, was funktioniert - und was nicht.
Die Messung des Erfolgs beginnt mit den Teilnehmerzahlen, sollte sich aber nicht darauf beschränken. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, sollten Sie sich folgendes ansehen:
- Reichweite: Mit wie vielen Personen haben Sie Kontakt aufgenommen - sowohl online als auch persönlich? Denken Sie dabei an verteilte Flugblätter, Teilnehmer anVeranstaltungen, Besuche auf Ihrer Plattform, Öffnungsraten von E-Mails.
- Qualität des Inputs: Erhalten Sie oberflächliche Reaktionen oder aussagekräftige Beiträge? Tauschen sich die Menschen untereinander aus oder reichen sie nur einzelne Antworten ein?
- Repräsentativität: Repräsentieren die teilnehmenden Personen die breitere Gemeinschaft, oder ist jedes Mal dieselbe Gruppe anwesend?
- Stimmungslage: Wie ist die allgemeine Stimmung der Unterhaltung? Sind die Leute hoffnungsvoll, frustriert oder verwirrt? Dies kann Ihnen viel darüber verraten, wie das Projekt ankommt.
- Zufriedenheit: Was denken die Teilnehmer*innen über den Prozess selbst? Haben sie verstanden, wie sie sich beteiligen können? Würden sie es wieder tun?
Diese Einblicke helfen Ihnen, Ihren Ansatz zu verfeinern, Lücken zu erkennen und frühzeitig Anpassungen vorzunehmen. Das stärkt auch Ihren internen Rückhalt. Wenn Sie nachweisen können, dass die Beteiligung zu repräsentativeren Beiträgen, besseren Entscheidungen oder größerem Vertrauen geführt hat, ist es viel einfacher, die Zustimmung für zukünftige Initiativen zu erhalten.
Wenn Sie eine Beteiligungsplattform wie Go Vocal verwenden, können Sie mit den integrierten Dashboards und der KI-Analysetool all dies in Echtzeit verfolgen. Das bedeutet, dass Sie Probleme erkennen können, während das Projekt noch im Gange ist, und sich entsprechend anpassen können.
Wie sieht hybride Beteiligung in der Praxis aus?
Statt theoretischer Empfehlungen gibt es hier konkrete Beispiele! Kürzlich haben wir zwei Expert*innen zu unserem Go Vocal Webinar eingeladen: Karin Engelhardt, zuständig für Innovation, Projektentwicklung und Partizipation in der Stadt Coburg. Und Wencke Hertzsch, Referatsleiterin des Wiener Klimateam der Stadt Wien. Mit ihnen haben wir über die Zukunft der Öffentlichkeitsbeteiligung – hybride Beteiligung – gesprochen.
Methodenmix in Coburg
In Coburg hat man den Auftakt in Bürger*innenbeteiligung mit einem Online-Ideenaufruf auf der neuen Beteiligungsplattform gestartet. Diese (neue) digitale Methode ergänzte das Beteiligungsteam von Karin Engelhardt um vielfältige Offline-Beteiligungsmöglichkeiten. So konnten die Menschen Papier(umfragen) beantworten, Ideen-Postkarten einsenden, oder Veranstaltungen und Informationsstände beim Stadtfest besuchen. Mit diesem hybriden Ansatz sei in kürzester Zeit geschafft worden, die Coburger*innen zu mobilisieren und ihre Ideen einzusammeln. Dank der mehrgleisigen Herangehensweise gingen 270 Ideen ein – bei einer Stadt mit nur rund 41.000 Einwohner*innen!
Inklusive Beteiligung in Wien
Wencke Hertzsch vom Wiener Klimateam der Stadt Wien gewährte Einblicke in bewährte Praktiken in ihre ungleich komplexer angelegte Beteiligung. Allein in der ersten Phase (einer zweijährigen Pilotphase in 3 Bezirken mit Budget von 13 Mio. Euro) gingen über 1100 Ideen ein. Eine repräsentativ geloste Gruppe an Bewohner*innen – das Klimateam – entschied pro Bezirk, welche Ideen mit den vorhandenen finanziellen Mitteln umgesetzt werden sollen. Die Umsetzung läuft bis Dezember 2024.
In Wien wird viel ausprobiert, um Barrieren und Hürden in der Beteiligung abzubauen. Auch in Bezug auf die Kommunikation ist man offen. Damit wirklich vielfältige Bürger*innengruppen für die Beteiligung erreicht werden, setzt man in Wien auf die aktive Unterstützung und Mobilisierung von Multiplikator*innen. Sie sind die Schlüsselkommunikator*innen in die verschiedensten Zielgruppen. Für im Bezirk aktive Gruppen, für Schulen und Vereine etc. wurde zudem eigens pädagogisches Material entwickelt, um einen spielerischen Zugang in die Partizipation zu ermöglichen. Die Online-Plattform läuft als transparenter Hauptkommunikator die ganze Zeit mit.
Ehrgeiziger Beteiligungsprozess für eine nachhaltige Zukunft in Wetzlar
Die Stadt Wetzlar wählte für die Entwicklung ihres Rahmenplans Altstadt eine hybride Beteiligungsstrategie, die sowohl digitale als auch Formate vor Ort kombinierte, um ein breites Spektrum von Bürger*innen zu erreichen.
Einerseits wurden die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Ideen und Kommentare asynchron über die Beteiligungsplattform Go Vocal einzureichen, um denjenigen, die von zu Hause aus teilnehmen wollten, einen niedrigschwelligen Zugang zu ermöglichen.
Andererseits veranstaltete die Stadt während des gesamten Prozesses zwölf persönliche Events, darunter öffentliche Workshops, Treffen mit Interessenvertretern sowie Jugendforen, die Gelegenheit zum Dialog, zur Mitgestaltung und zum differenzierten Austausch boten. Diese Kombination ermöglichte es der Stadt, über 1.100 Beiträge zu sammeln und das Momentum während des einjährigen Beteiligungszeitraums aufrechtzuerhalten.
Durch das Angebot mehrerer Einstiegspunkte in den Prozess - digital, persönlich, individuell und gruppenbasiert - stellte Wetzlar sicher, dass die Einwohner*innen mit unterschiedlicher Verfügbarkeit, Kommunikationsstil und unterschiedlicher Teilnahmebereitschaft einen sinnvollen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft ihres historischen Stadtzentrums leisten konnten.
Erfolgreiche hybride Beteiligungsformate
Mit einer hybriden Herangehensweise – der Kombination von Online- und Offline Methoden – werden Bürger*innen für Partizipation abgeholt. Der Methoden-Mix muss für die Zielgruppen stimmig und verständlich sein, dann entsteht auch eine breite Beteiligung, die nicht nur wichtig für die Demokratiesicherung ist, sondern auch Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit schafft.
Starten wir jetzt!
Karin Engelhardt ermutigt jeden, Beteiligung auszuprobieren. Auch Wencke Hertzsch meint: Seien Sie mutig, bringen Sie Ihre Beteiligung einfach auf den Weg. Wenn auch Sie erfahren wollen, wie man verschiedene Beteiligungsmethoden am besten kombiniert, buchen Sie ein Beratungsgespräch mit uns!




.webp)

.webp)